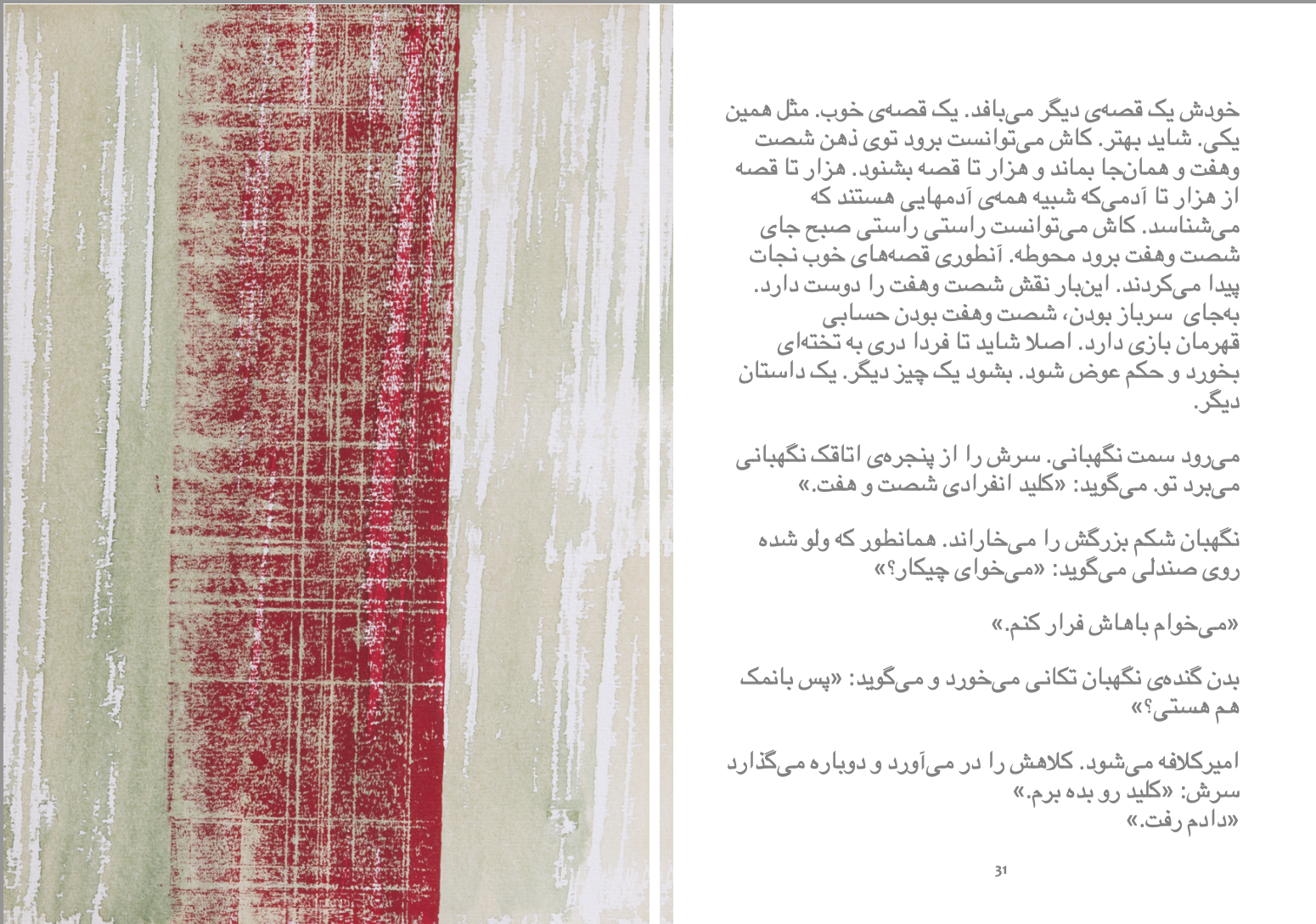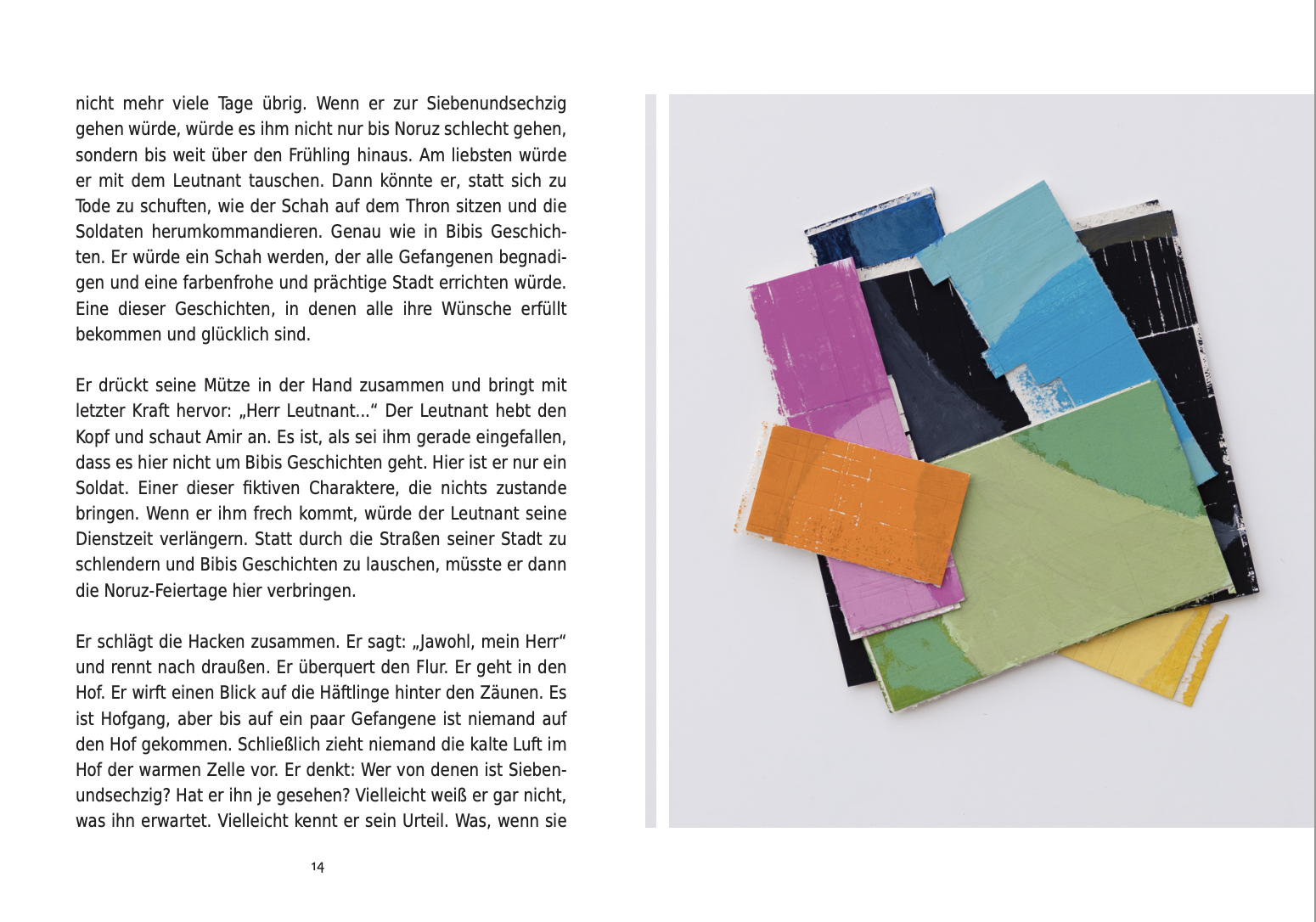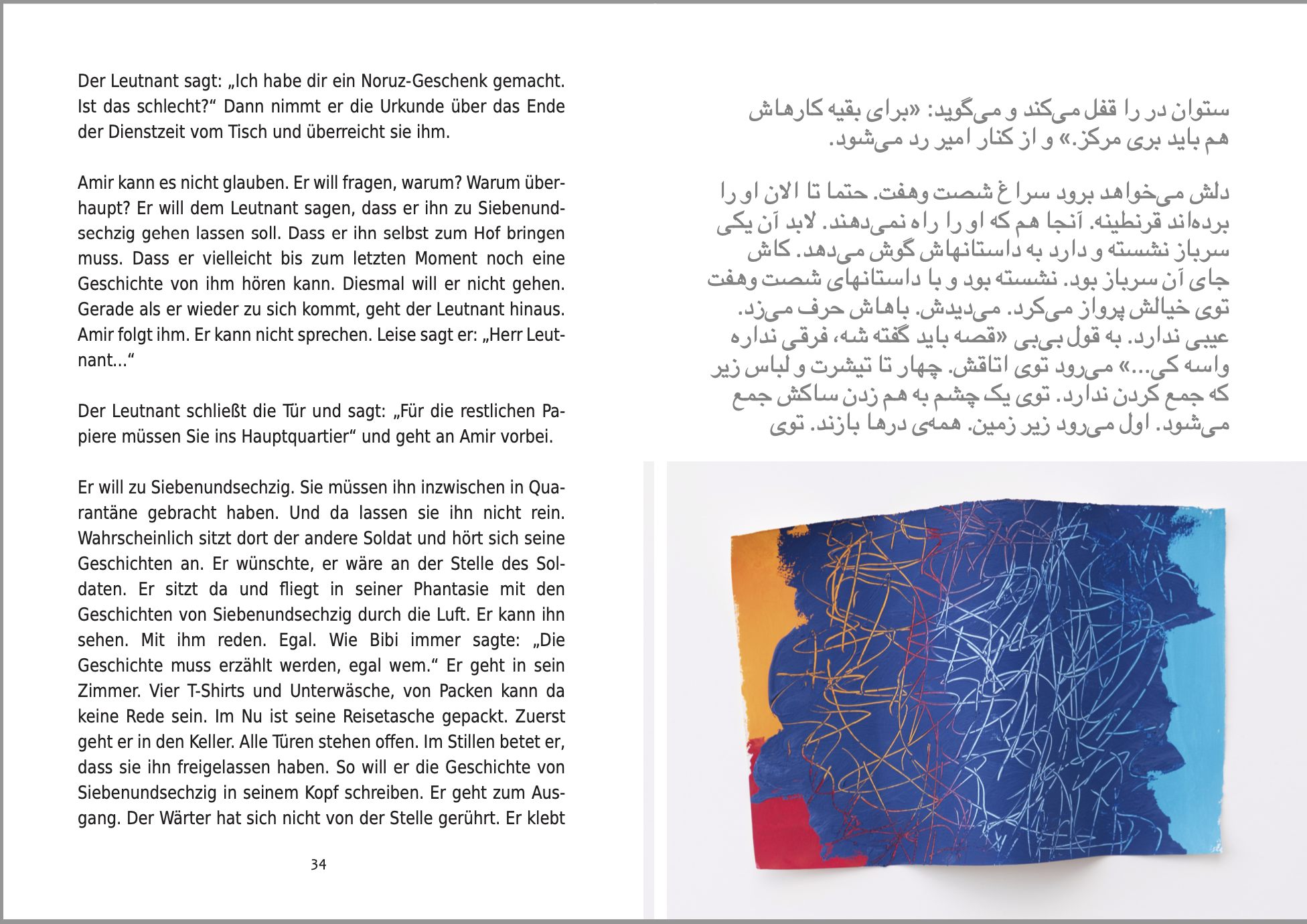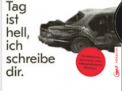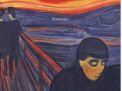Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit
Autor(en): Pajand Soleymani (Text), Ina Abuschenko-Matwejewa (Bilder), Nuschin Mameghanian-Prenzlow (Übersetzung)
Bübül Verlag Berlin » Literarische Texte » Erzählungen, Gedichte, Prosa - Sie können unsere Bücher auch direkt bei unserer Auslieferung team4@rungeva.de bestellen!
In einem Gefängnis in Iran bringt Amir, der dort arbeitet, der "Siebenundsechzig", einem zum Tode Verurteilten, seine letzte Mahlzeit. Beide lieben Geschichten. Doch was können sie angesichts des Todes bedeuten? Eine Erzählung auf Persisch und Deutsch
Zusammenfassung
Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit
Herausgeber: Bübül Verlag Berlin (2025)
ISBN-13: 978-3-946807-67-4
Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit
Herausgeber: Bübül Verlag Berlin (2025)
ISBN-13: 978-3-946807-67-4
Pajand Soleymani
Das Ende der Dienstzeit
persisch-deutsch
Übersetzung von Nuschin Mameghanian-Prenzlow
40 Seiten
auf nachhaltigem Papier in Deutschland gedruckt
mit farbigen künstlerischen Arbeiten von Ina Abuschenko-Matwejewa
Fadenheftung
16 Euro
Jetzt im Bübül Verlag erhältlich!
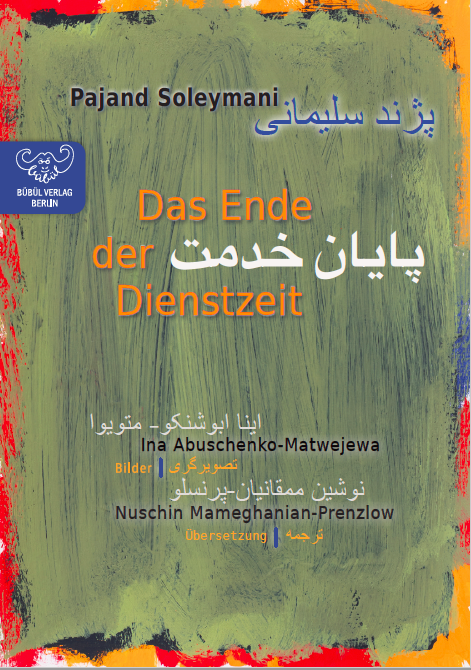
Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit Artikel Nr.: 955269936
Preis: